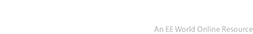J
Joerg
Guest
Jürgen Hüser wrote:
eine Stromquelle. Er stellt sich so ein, dass Vbe plus das was am
Emitterwiderstand abfaellt der Elektret-Ruhespannung entspricht. D.h.
bei 12V Versorgung liegt der Kollektor dann bei gut 10V. Aber da Du ja
kapazitiv von dort weitergehst duerfte das egal sein, die 800mVpp
schafft er dann immer noch.
Wenn die Elektret-Ruhespannung driftet verschiebt sich der Arbeitspunkt,
aber es musste schon extrem werden dass die Transistorstufe ins Clipping
geht.
--
Gruesse, Joerg
http://www.analogconsultants.com/
"gmail" domain blocked because of excessive spam.
Use another domain or send PM.
[...]Hallo Jörg!
Joerg schrieb:
Berechne es einfach fuer den 4V Fall. Der Transistor verhaelt sich wieTransistorstufen fallen also schonmal wech, da der Arbeitspunkt je
nach Betriebsspannung überall sein mag, nur nicht dort wo man ihn
gerne hätte
Aehm, wieso? Transistor mit der Basis direkt ans Elektret, plus der
uebliche Widerstand nach V+ um die Kapsel zu versorgen. Das setzt
gleichzeitig die Basisspannung, in der Hoffung das selbige ueber einem
Volt liegt. Falls nicht gibt es noch andere Tricks.
Nun einen Widerstand von Emitter nach Masse der den Ruhestrom
festlegt. Selbigen mit einem Serien-RC ueberbruecken, mit dem R wird
die Verstaerkung eingestellt. Vom Kollektor nach Plus auch noch einen
Widerstand und zwar so gross, dass sich am Kollektor etwa die Mitte
zwischen V+ und Emitterspannung einstellt. Vom Kollektor kapazitiv auf
den Eingang des Funkgeraetes. Dat isset dann schon.
Ehrlich gesagt wären mir Transistoren schon lieber.
Nur auch wenn ich statt mit einem Spannungsteiler den Basisstrom nur
mittels CB-Widerstand und Emitterwiderstand festlege, funktioniert das
doch nur innerhalb eines sehr schmalen Betriebsspannungsbereiches.
Also müsste ich in jedem einzelnen Fall erstmal abhängig von der
verfügbaren Spannung alle Widerstände rund um den Transistor berechnen
müssen. Oder?
eine Stromquelle. Er stellt sich so ein, dass Vbe plus das was am
Emitterwiderstand abfaellt der Elektret-Ruhespannung entspricht. D.h.
bei 12V Versorgung liegt der Kollektor dann bei gut 10V. Aber da Du ja
kapazitiv von dort weitergehst duerfte das egal sein, die 800mVpp
schafft er dann immer noch.
Wenn die Elektret-Ruhespannung driftet verschiebt sich der Arbeitspunkt,
aber es musste schon extrem werden dass die Transistorstufe ins Clipping
geht.
Ok, aber ein Opamp ist irgendwie Kanone auf Spatzen ;-)Hmm, muß ich mal ausprobieren, wie sich sowas von 4-12V verhält.
CMOS ist schonmal gut, gibt weniger interne EMV Probleme. Aber:
Elektretkapseln streuen in der sich ergebenden Gleichspannung recht
stark. Willst Du das jedesmal austrimmen? Irgendwie erscheint das mit
dem Transistor einfacher.
Eben daher habe ich auch nie an eine DC-Verbindung zum OP-Eingang
gedacht. Kapazitiv gekoppelt um die Vorspannung der Kapsel vom OP wech
zu halten.
--
Gruesse, Joerg
http://www.analogconsultants.com/
"gmail" domain blocked because of excessive spam.
Use another domain or send PM.