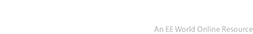R
Reinhard Zwirner
Guest
Hi,
auch wenn es fĂźr mich eher peinlich ist, wollte ich hier doch eine
kleine Geschichte erzählen, um Euch vor dem Reintappen in eine
ähnlich gelagerte Falle zu warnen.
Ich habe mir also fĂźr Quick-and-dirty-Tests so ein kleines
AVR-Testmaschinchen besorgt:
<http://www.ebay.de/itm/GM328-LCD-Anzeige-Transistor-Tester-ESR-Meter-Cymometer-Rechteckgenerator-DE-/281580731416?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item418f84fc18>
Beim Ausprobieren funktionierte alles wie erhofft/erwartet. Dann
steckte ich eine der OA81s, die ich in einem kĂźrzlichen Thread zum
Ausprobieren angeboten hatte, die aber keiner haben wollte, in die
Testaufnahme und drßckte den Startknopf: uups, Uf war gut 800 mV. Hä?
Andere OA81: Testergebnis gleicher GrĂśĂenordnung. GrĂźbel, grĂźbel. Im
AVR-Forum nachgefragt, etliche Messungen gemacht und gepostet.
SchlieĂlich die LĂśsung: Bei diesen Dioden wie offenbar den meisten
GE-Dioden liegt die FluĂspannung schon bei wenigen mA Vorwärtsstrom
in der GrĂśĂenordnung von 1 V! Hätte auch so im Datenbuch nachgelesen
werden kĂśnnen. Aber man (zumindest ich bisher) hat bei GE-Dioden als
Uf halt 200-300 mV im Hinterkopf!
Bei einer Golddraht-Diode OA 180 war die Welt dann aber wieder in
Ordnung ;-)!
HTH
Reinhard
auch wenn es fĂźr mich eher peinlich ist, wollte ich hier doch eine
kleine Geschichte erzählen, um Euch vor dem Reintappen in eine
ähnlich gelagerte Falle zu warnen.
Ich habe mir also fĂźr Quick-and-dirty-Tests so ein kleines
AVR-Testmaschinchen besorgt:
<http://www.ebay.de/itm/GM328-LCD-Anzeige-Transistor-Tester-ESR-Meter-Cymometer-Rechteckgenerator-DE-/281580731416?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item418f84fc18>
Beim Ausprobieren funktionierte alles wie erhofft/erwartet. Dann
steckte ich eine der OA81s, die ich in einem kĂźrzlichen Thread zum
Ausprobieren angeboten hatte, die aber keiner haben wollte, in die
Testaufnahme und drßckte den Startknopf: uups, Uf war gut 800 mV. Hä?
Andere OA81: Testergebnis gleicher GrĂśĂenordnung. GrĂźbel, grĂźbel. Im
AVR-Forum nachgefragt, etliche Messungen gemacht und gepostet.
SchlieĂlich die LĂśsung: Bei diesen Dioden wie offenbar den meisten
GE-Dioden liegt die FluĂspannung schon bei wenigen mA Vorwärtsstrom
in der GrĂśĂenordnung von 1 V! Hätte auch so im Datenbuch nachgelesen
werden kĂśnnen. Aber man (zumindest ich bisher) hat bei GE-Dioden als
Uf halt 200-300 mV im Hinterkopf!
Bei einer Golddraht-Diode OA 180 war die Welt dann aber wieder in
Ordnung ;-)!
HTH
Reinhard