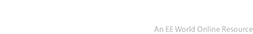K
Kai-Martin Knaak
Guest
Hier mĂśchte ein Projekt fette AluklĂśtze super genau und superstabil
mit einem Duzend Peltierelementen auf einer bestimmten Temperatur halten.
Dabei fallen im Aluklotz etwa 40 W Abwärme an, die es durch die Peltiers
abzufĂźhren gilt.
Im kleineren MaĂstab, also fĂźr einige cm^3 AluklĂśtze und etwa 1W Abwärme
ist das hier Routine. Die Serie der zugehĂśrigen Regler-Treiber-Elektronik
nähert sich hier der dreistelligen Stßckzahl. Messung und Regler sind also
vorhanden. Aber die Endstufe ist natĂźrlich deutlich zu schwach fĂźr die 40 W.
Wobei man die Effizenz der Peltiers auch nicht bei 1 liegen wird und die
elektrische Leistung entsprechend hĂśher ausfallen wird.
Bei der Entwicklung einer an diesen Zweck angepassten Endstufe befĂźrchte
ich mangels Erfahrung den einen oder anderen, Designfehler einzubauen -- Mit
entsprechenden Auswirkungen auf die Zeit bis zum fertigen Gerät. Um diese
Klippen zu umschiffen, denke ich daran, preiswerte Labornetzgeräte als
Endstufe umzuwidmen. Die Idee ist, dessen Strom statt mit dem Potentiometer
vom Ausgang des Reglers einstellen zu lassen. (Gegen den Einwand, dass eine
passende Endstufe preislich viel gĂźnstiger kommt, steht die Tatsache, dass
auch dann noch ein linear-geregeltes Netzteil passender Leistungsklasse
daneben gestellt werden muss. Schaltnetzteile kommen wegen der EMV-Hygiene
nicht in Frage.)
Bleibt also die Frage, wie ich das Poti elektrisch ersetze. Ich habe etwas
in einem der von Pollin erhältlichen Modelle (DF1730LCD, Bestnr. 350 090).
Ergebnis: Das Strompoti ist logarithmisch und hat einen Nennwert von 6.8 k
(Bezeichnung 6K8A) Es ist als regelbarer Widerstand beschaltet. Wie die
Schaltung insgesamt aussieht, war etwas unĂźbersichtlich. Nun ist ein
allgemeiner, elektrisch einstellbarer, floatender Widerstand nicht wirklich
trivial. Aber ich denke, in diesem Fall kĂśnnte die Schummel-LĂśsung mit einem
von einer LED beleuchteten LDR passen. (Oder hat jemand eine bessere
Idee?)
Frage: Ist irgendwo der Schaltplan solcher Billig-Labornetzteile einsehbar
damit ich besser weiĂ, was ich da tu? Dem äuĂeren Anschein nach dĂźrften die
meisten Geräte grob gleich aufgebaut sein -- Gleiche Funktionen, gleiche
KnĂśpfe, gleiche Specs.. Ja, das kĂśnnte man durch Nachverfolgen der Leiterbahnen
heraus puzzeln. Um so eine FleiĂarbeit wĂźrde ich aber gerne herum kommen.
---< kaimartin(>---
kaimartin(>---
--
Kai-Martin Knaak tel: +49-511-762-2895
Universität Hannover, Inst. fßr Quantenoptik fax: +49-511-762-2211
Welfengarten 1, 30167 Hannover http://www.iqo.uni-hannover.de
GPG key: http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?search=Knaak+kmk&op=get
mit einem Duzend Peltierelementen auf einer bestimmten Temperatur halten.
Dabei fallen im Aluklotz etwa 40 W Abwärme an, die es durch die Peltiers
abzufĂźhren gilt.
Im kleineren MaĂstab, also fĂźr einige cm^3 AluklĂśtze und etwa 1W Abwärme
ist das hier Routine. Die Serie der zugehĂśrigen Regler-Treiber-Elektronik
nähert sich hier der dreistelligen Stßckzahl. Messung und Regler sind also
vorhanden. Aber die Endstufe ist natĂźrlich deutlich zu schwach fĂźr die 40 W.
Wobei man die Effizenz der Peltiers auch nicht bei 1 liegen wird und die
elektrische Leistung entsprechend hĂśher ausfallen wird.
Bei der Entwicklung einer an diesen Zweck angepassten Endstufe befĂźrchte
ich mangels Erfahrung den einen oder anderen, Designfehler einzubauen -- Mit
entsprechenden Auswirkungen auf die Zeit bis zum fertigen Gerät. Um diese
Klippen zu umschiffen, denke ich daran, preiswerte Labornetzgeräte als
Endstufe umzuwidmen. Die Idee ist, dessen Strom statt mit dem Potentiometer
vom Ausgang des Reglers einstellen zu lassen. (Gegen den Einwand, dass eine
passende Endstufe preislich viel gĂźnstiger kommt, steht die Tatsache, dass
auch dann noch ein linear-geregeltes Netzteil passender Leistungsklasse
daneben gestellt werden muss. Schaltnetzteile kommen wegen der EMV-Hygiene
nicht in Frage.)
Bleibt also die Frage, wie ich das Poti elektrisch ersetze. Ich habe etwas
in einem der von Pollin erhältlichen Modelle (DF1730LCD, Bestnr. 350 090).
Ergebnis: Das Strompoti ist logarithmisch und hat einen Nennwert von 6.8 k
(Bezeichnung 6K8A) Es ist als regelbarer Widerstand beschaltet. Wie die
Schaltung insgesamt aussieht, war etwas unĂźbersichtlich. Nun ist ein
allgemeiner, elektrisch einstellbarer, floatender Widerstand nicht wirklich
trivial. Aber ich denke, in diesem Fall kĂśnnte die Schummel-LĂśsung mit einem
von einer LED beleuchteten LDR passen. (Oder hat jemand eine bessere
Idee?)
Frage: Ist irgendwo der Schaltplan solcher Billig-Labornetzteile einsehbar
damit ich besser weiĂ, was ich da tu? Dem äuĂeren Anschein nach dĂźrften die
meisten Geräte grob gleich aufgebaut sein -- Gleiche Funktionen, gleiche
KnĂśpfe, gleiche Specs.. Ja, das kĂśnnte man durch Nachverfolgen der Leiterbahnen
heraus puzzeln. Um so eine FleiĂarbeit wĂźrde ich aber gerne herum kommen.
---<
--
Kai-Martin Knaak tel: +49-511-762-2895
Universität Hannover, Inst. fßr Quantenoptik fax: +49-511-762-2211
Welfengarten 1, 30167 Hannover http://www.iqo.uni-hannover.de
GPG key: http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?search=Knaak+kmk&op=get