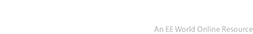M
Michael Schwingen
Guest
On 2016-10-24, Wolfgang Schreiber <cool-it@gmx.de> wrote:
Ich habe letztens diesen Link hier notiert:
https://github.com/eez-open/psu-hw
aber noch keiner Zeit gehabt, mir das im Detail anzusehen.
cu
Michael
Die Schaltung ist in der Tat offenbar Murks, sowohl in der Konzeption
wie in meiner konkreten Ausführung. Aber es scheint keine
verbesserte Version zu geben, im Netz finde ich nur Berge von
halblebigen Projekten. Und natürlich die üblichen "Ich möchte
geschwind ein 100V/40A-Labornetzteil bauen." Ohne den Bloggern
zu nahe treten zu wollen, aber die meisten Seiten mit einem
Netzteilprojekt machen nicht den Eindruck, auf Herz und Nieren
geprüft worden zu sein. Wie man an den Links in der dse-FAQ
sieht, sind sie sogar oft fehlerbehaftet. Und irgendwie gibt es
kein definitives Projekt, das für 30V/3-6A wie hier paßt.
Ich habe letztens diesen Link hier notiert:
https://github.com/eez-open/psu-hw
aber noch keiner Zeit gehabt, mir das im Detail anzusehen.
cu
Michael