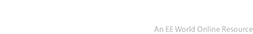D
Dieter Wiedmann
Guest
Hartmut Feller schrieb:
Gruß Dieter
http://de.wikipedia.org/wiki/Kolophonium3. NUR Elektroniklot mit Kolophonium-Flußmittel, kein "Radiolot" mit
Harzinnereien verwenden.
Gruß Dieter