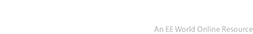M
Marcel Müller
Guest
Hallo,
mit wieviel ESR muss man eigentlich bei keramischen Kondensatoren im
einstelligen nF-Bereich so im unteren MHz-Bereich typischerweise rechnen?
Hintergrund: ich muss Spannungsspitzen einer Streuinduktivität (ca.
200nH, 6,5A) in einem SNT abfedern. Da habe ich ein Netzwerk mit 3,3nF,
einer Diode und einem 1k-Widerstand zum entladen ausgerechnet. Das
funktioniert im Prinzip auch, nur ist die erreichte Spitzenspannung (ca.
90V) um einiges höher, als ich es erwarten würde (ca 50V). (Berechnet
über Energiegleichsetzung)
Ich vermute, dass der kleine Kondensator beim Abschalten des FET nicht
einfach so die 6,5A übernehmen kann, ohne selbst einen nennenswerten
Spannungsabfall zu erzeugen. Warm wird es nicht; das ist aber auch nicht
überraschend, da die Energiemenge ja relativ klein ist.
Deshalb wollte ich mal fragen, was die Kerkos so typischerweise für
Innenwiderstände haben, oder ob ich doch an anderer Stelle weitersuchen
muss.
Marcel
mit wieviel ESR muss man eigentlich bei keramischen Kondensatoren im
einstelligen nF-Bereich so im unteren MHz-Bereich typischerweise rechnen?
Hintergrund: ich muss Spannungsspitzen einer Streuinduktivität (ca.
200nH, 6,5A) in einem SNT abfedern. Da habe ich ein Netzwerk mit 3,3nF,
einer Diode und einem 1k-Widerstand zum entladen ausgerechnet. Das
funktioniert im Prinzip auch, nur ist die erreichte Spitzenspannung (ca.
90V) um einiges höher, als ich es erwarten würde (ca 50V). (Berechnet
über Energiegleichsetzung)
Ich vermute, dass der kleine Kondensator beim Abschalten des FET nicht
einfach so die 6,5A übernehmen kann, ohne selbst einen nennenswerten
Spannungsabfall zu erzeugen. Warm wird es nicht; das ist aber auch nicht
überraschend, da die Energiemenge ja relativ klein ist.
Deshalb wollte ich mal fragen, was die Kerkos so typischerweise für
Innenwiderstände haben, oder ob ich doch an anderer Stelle weitersuchen
muss.
Marcel