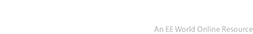M
Martin Laabs
Guest
Hallo,
ich habe mal ne ganz doofe Frage, die mich aber schon länger
beschäftigt. Warum arbeitet man bei HF immer mit Leistungsanpassung?
Warum macht man bei Endstufen keine Spannungsanpassung um so
den Wirkungsgrad zu erhöhen?
Die Reflexionen am Übergang von Transistor zu Kabel dürften doch
nicht wirklich stören.
Danke
Martin L.
ich habe mal ne ganz doofe Frage, die mich aber schon länger
beschäftigt. Warum arbeitet man bei HF immer mit Leistungsanpassung?
Warum macht man bei Endstufen keine Spannungsanpassung um so
den Wirkungsgrad zu erhöhen?
Die Reflexionen am Übergang von Transistor zu Kabel dürften doch
nicht wirklich stören.
Danke
Martin L.