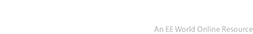J
Joerg
Guest
Hallo Rafael,
Gruesse, Joerg
http://www.analogconsultants.com
Das spricht aber nicht unbedingt fuer die Qualitaet des UART Chips.Ich hatte mit Kaskade aus 1x 74HC04 Oszillator ca. 8MHz und 2x
74HC04 zur Versteilerung schonmal Problem daß Signal ( am 20 MHz
Hameg ) ok aussah, aber ein 4fach-UART-IC merkwürdigste sporadische
Fehler erzeugte. Hat ne Weile gedauert bis ich dahinterkam, daß ihm
der Takt zu unedel war.
Gruesse, Joerg
http://www.analogconsultants.com