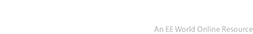W
Winfried Salomon
Guest
Hallo Joerg,
Joerg wrote:
stehen die da oben drin:
C COPYRIGHT BY RUHR-UNIVERSITAET BOCHUM >> 1986 << *
C LEHRSTUHL FUER NACHRICHTENTECHNIK *
C POSTFACH 10 21 48 *
C 4630 BOCHUM *
C WEST-GERMANY *
C*******************************************************
Das steht im Quellcode des "Falcon" drin, den ich hier habe und den ich
selbst an Sun Solaris und MS-Windows angepaßt habe. Für Lehr- und
Forschungszwecke scheint es bei uns einsetzbar zu sein, es ist ein sehr
gutes Instrument, aber ohne das Handbuch (nur in Papierform verfügbar)
fast nicht bedienbar. Es kann sogar sein, daß Siemens da irgendwie mit
drinhängt, also wird das mit den Rechten vermutlich nicht so einfach
sein. Es kann noch viel mehr als WDFs, aber wahrscheinlich ist es nie
für die Allgemeinheit wie z.B. Spice gedacht gewesen.
Kapitel beschäftigt. Soweit ich in Kürze erkennen kann, leitet
Mildenberger das von analogen Strukturen ab, die wieder andere als
LC-Kettenleiter sind, offenbar gibt es da viele verschiedene
Lösungsansätze. Es könnte sein, das man zur Bestimmung der "Reflektanz"
erstmal die analoge Form der Schaltung komplett vorliegen haben muß, das
ist mir selbst im Moment für die LC-Kettenleiter aber nicht möglich,
da habe ich noch nie eine verständliche Erklärung irgendwo gefunden.
Normalerweise nimmt man dazu die Tabellenbücher von Pfitzenmaier oder
Saal oder so.
 . Das ist genau der Referenz-Artikel, nach dem bei uns
. Das ist genau der Referenz-Artikel, nach dem bei uns
entwickelt wurde. Das ist zwar hartes Brot, aber wenn Du mal
konzentriert nachliest wirst Du sicher bemerken, daß da regelrechte
fertige "Kochrezepte" drinstehen. Es wird an einigen Standard-Beispielen
gezeigt, wie man die Gamma-Koeffizienten der Adaptoren berechnet und die
möglichen passenden Schaltungsstrukturen stehen auch da. Den Ersatz der
Multiplizierer durch Shift and Add im CSD-Code mußt Du noch selbst
machen, das ist dann eine Optimierungssache, vielleicht per eigenem
Programm. So eine Handoptimierung halte ich zwar für aufwendig, aber
nicht für grundsätzlich schwierig, denn der Frequenzgang einer solchen
Schaltung ist sehr leicht berechenbar.
da eine UNI-Bibliothek ein, die haben meist große Sammlungen.
mfg. Winfried
Joerg wrote:
dieses Programm ist an der Ruhr-Uni Bochum entstanden und als AutorenHallo Winfried,
das Problem scheint mir in erster Linie da zu liegen, von vorhandenen
Filterkoeffizienten im Z-Bereich auf die Koeffizienten für die
Adaptoren zu kommen. Aus den sehr theoretischen Zeitschriftenartikeln,
die ich hier so sehe, kann man das nicht so ohne weiteres entnehmen.
Die Adaptoren selbst sind sehr einfach aufgebaut und die Sache des
Ersatzes der Multiplizierer durch Shift and Add kann man auch so
irgendwie hinkriegen. Bei uns wurden solche WDFs entwickelt, aber mit
dem Programm "Falcon" von Lajos GAZSI und Gonzalo LUCIONI, das jedoch
nicht frei ist.
Ich werde mal danach suchen. Wenn es eine Demoversion zum Probieren gibt
und die normale Version nicht astronomisch teuer ist, Freeware muss es
nicht sein. Die haben ja auch Arbeit hineingesteckt.
stehen die da oben drin:
C COPYRIGHT BY RUHR-UNIVERSITAET BOCHUM >> 1986 << *
C LEHRSTUHL FUER NACHRICHTENTECHNIK *
C POSTFACH 10 21 48 *
C 4630 BOCHUM *
C WEST-GERMANY *
C*******************************************************
Das steht im Quellcode des "Falcon" drin, den ich hier habe und den ich
selbst an Sun Solaris und MS-Windows angepaßt habe. Für Lehr- und
Forschungszwecke scheint es bei uns einsetzbar zu sein, es ist ein sehr
gutes Instrument, aber ohne das Handbuch (nur in Papierform verfügbar)
fast nicht bedienbar. Es kann sogar sein, daß Siemens da irgendwie mit
drinhängt, also wird das mit den Rechten vermutlich nicht so einfach
sein. Es kann noch viel mehr als WDFs, aber wahrscheinlich ist es nie
für die Allgemeinheit wie z.B. Spice gedacht gewesen.
Das Buch habe ich zufällig hier auch, mich allerdings nicht mit diesemProf.Mildenberger's Programm war auch nicht kostenlos, als ich es
kaufte. Ich glaube, heute ist es das. Funktioniert ganz gut, aber die
Doku ist arg duenn. Zum Beispiel fand ich nicht, was er mit
"Betriebsfrequenz" meint. Habe ihm gestern geschrieben, mal sehen.
Kapitel beschäftigt. Soweit ich in Kürze erkennen kann, leitet
Mildenberger das von analogen Strukturen ab, die wieder andere als
LC-Kettenleiter sind, offenbar gibt es da viele verschiedene
Lösungsansätze. Es könnte sein, das man zur Bestimmung der "Reflektanz"
erstmal die analoge Form der Schaltung komplett vorliegen haben muß, das
ist mir selbst im Moment für die LC-Kettenleiter aber nicht möglich,
da habe ich noch nie eine verständliche Erklärung irgendwo gefunden.
Normalerweise nimmt man dazu die Tabellenbücher von Pfitzenmaier oder
Saal oder so.
Ah, gutDiese WDFs wurden nicht nur in FPGAs mit hoher Taktfrequenz, sondern
auch in einem DTMF-Decoder im Arm-Controller implementiert und
funktionieren. Der Vorteil war offenbar die Stabilität und geringere
Wortbreite, der Hardwareaufwand ist höher. Ich habe die relevanten
Zeitschriftenartikel von Gaszi und Fettweis hier auch nicht zur
Verfügung, aber wenn da nicht die Berechnung der WDF-Koeffizienten
"konkret" drinsteht, wird das wohl kaum jemand machen können.
Den Artikel von Gaszi hatte ich gestern hier gefunden:
http://homepage.te.hik.se/personal/tkhsi/advanced%20signal%20and%20system/signal%20processing/magnus/01085595.pdf
entwickelt wurde. Das ist zwar hartes Brot, aber wenn Du mal
konzentriert nachliest wirst Du sicher bemerken, daß da regelrechte
fertige "Kochrezepte" drinstehen. Es wird an einigen Standard-Beispielen
gezeigt, wie man die Gamma-Koeffizienten der Adaptoren berechnet und die
möglichen passenden Schaltungsstrukturen stehen auch da. Den Ersatz der
Multiplizierer durch Shift and Add im CSD-Code mußt Du noch selbst
machen, das ist dann eine Optimierungssache, vielleicht per eigenem
Programm. So eine Handoptimierung halte ich zwar für aufwendig, aber
nicht für grundsätzlich schwierig, denn der Frequenzgang einer solchen
Schaltung ist sehr leicht berechenbar.
Ich bin nicht sicher, ob Du den noch brauchst, aber als Quelle fiele mirFettweis war allerdings nirgends zu finden, und genau das waere ja der
Ur-WDF Artikel.
da eine UNI-Bibliothek ein, die haben meist große Sammlungen.
mfg. Winfried