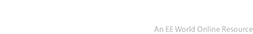J
Johannes Bauer
Guest
Hallo Gruppe,
wie bereits vor ein Paar Wochen mal geschrieben habe ich einen
Audio-Verstärker gebaut. Dazu habe ich mich nun doch für eine 2xTDA2030
Variante entschieden. Heute habe ich mir eine hübsche Platine geätzt und
das Ding aufgebaut.
Der linke Kanal funktioniert einwandfrei. Aber mit dem rechten habe ich
mich selber übertroffen: neben einem richtig lauten 50Hz-Brumm kriege
ich sogar noch (bei richtiger Haltung der Platine) deutlich hörbar
irgendwas rein, was sich nach einem Radio in einer slavischen Sprache
anhört. "Der Radiomann" wäre stolz auf mich. Leider nicht Sinn der Sache.
Ich gebe zu: ich habe beim Layouten gepfuscht. Schnell schnell geroutet
und die Bauteile auf eine kleine Platine gebatzt wie's nur ging. Ich hab
gehofft, es wird nicht so schlimm.
Für die nächste Revision würde ich das LAyout alledings gerne richtig
machen. Gibt es wichtige Leitlinien für den Bau? Ich habe schon eine
große Massefläche, aber welche Signale sind im Routing kritisch? Ich
verwende (hauptsächlich) die Standardbeschaltung aus dem Datenblatt für
ein Split Power Supply (zwei Mal versteht sich).
Viele Grüße,
Johannes
wie bereits vor ein Paar Wochen mal geschrieben habe ich einen
Audio-Verstärker gebaut. Dazu habe ich mich nun doch für eine 2xTDA2030
Variante entschieden. Heute habe ich mir eine hübsche Platine geätzt und
das Ding aufgebaut.
Der linke Kanal funktioniert einwandfrei. Aber mit dem rechten habe ich
mich selber übertroffen: neben einem richtig lauten 50Hz-Brumm kriege
ich sogar noch (bei richtiger Haltung der Platine) deutlich hörbar
irgendwas rein, was sich nach einem Radio in einer slavischen Sprache
anhört. "Der Radiomann" wäre stolz auf mich. Leider nicht Sinn der Sache.
Ich gebe zu: ich habe beim Layouten gepfuscht. Schnell schnell geroutet
und die Bauteile auf eine kleine Platine gebatzt wie's nur ging. Ich hab
gehofft, es wird nicht so schlimm.
Für die nächste Revision würde ich das LAyout alledings gerne richtig
machen. Gibt es wichtige Leitlinien für den Bau? Ich habe schon eine
große Massefläche, aber welche Signale sind im Routing kritisch? Ich
verwende (hauptsächlich) die Standardbeschaltung aus dem Datenblatt für
ein Split Power Supply (zwei Mal versteht sich).
Viele Grüße,
Johannes