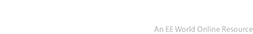M
Michael Eggert
Guest
Marc Santhoff <m.santhoff@t-online.de> wrote:
Moin!
Nein, solange die Anordnung der Stifte zueinander spiegelbildlich ist
und sie rechtwinklig im Vakuumtisch stecken, kann die Platine sowohl
eine beliebige Außenkontur haben (außer kreisrund) als auch die Kante
ein beliebiges Profil.
Gruß,
Michael.
Moin!
Die notwendige Präzision sollte man schon erreichen können, indem man
- einen Vakuumtisch benutzt (dann liegt die Platine schön eben, was
auch der Fokussierung entgegenkommt)
- mit einer ordentlichen CNC-Maschine Bohrungen für Stifte in
definiertem Abstand in den Tisch setzt
- die Platine am Rand wirklich rechtwinklig und plan gefräst ist, damit
es beim Wenden keinen Versatz gibt.
Nein, solange die Anordnung der Stifte zueinander spiegelbildlich ist
und sie rechtwinklig im Vakuumtisch stecken, kann die Platine sowohl
eine beliebige Außenkontur haben (außer kreisrund) als auch die Kante
ein beliebiges Profil.
Gruß,
Michael.