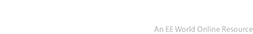R
Rainer Goellner
Guest
Hallo ihr da draussen,
Suche Hilfe wegen eines Dual-Labornetzgeraets, das
ich in alten Zeiten gebastelt habe. Der Spannungs-
regelbereich beginnt bei 0V, ab einem einstellbaren
Strom schaltet die Spannung ab (hab ich nicht
eingezeichnet). Die Vorlage stammt aus einer Elektor,
Platinennummer 83121, also wohl Jahrgang 1983; den
Artikel habe ich nicht mehr.
Das Ding habe ich nie richtig zum Laufen gebracht.
Der positive Zweig ist ok, aber der negative macht
Ärger. -Ua wirbelt herum, oder C2b (ein Tantalo)
schlägt gleich durch.
Das ist der relevante Schaltungsteil:
IC1a
_________
+Uv | | +Ua
O-------------o--|In Out|--o------------------o----O
| 2| adj |3 | |
| '---------' | |
off | 1| ___ | |
O----o---o----|------ o-|___|-o |
| | | | R1a | |
,-, | | | | |
| |<-' +| | |+ ,-,
| |P1 ### === ### | |
'-' --- |C3 --- | |R2a
| |C1a | |C2a '-'
| | | | |
O----|--o-----o-------o-------o-------------o----|----O
GND | | | | | | GND
| V |+ |+ +5V | |
| - ### ### O | |
| |D1 --- --- | | |
| V |C1b |C2b 7|/|3 | |
| - | | IC2/+|--' ,-,
| |D2 | ,-------|---o---< | | |
'- o | | | | 6 \-|--o-->| |P2
| | | | === 4|\|2 | '-'
,-, | | | |C4 | | |
| | | | ___ | '----|----' ,-,
| |R3 | o-|___|-o | | |
'-' | | R1b | | | |R2b
| | ___1|____ | | '-'
| | 3| adj |2 | | |
O-------o-----o--|In Out|--o--------o---------o----O
-Uv | | -Ua
'---------'
IC1b
Kurz zur Funktion:
IC1a ist fast in Standardschaltung, P1/R1a legen +Ua fest.
P1 liegt zwei PN-Übergänge unter 0V, damit der Ausgang bis
0V herunter gehen kann. Was C3 soll, weiss ich nicht, zur
Brummunterdrückung ist er jedenfalls zu klein. An off liegt
der (abgeklemmte) Ausgang des Stromfühlers.
An IC1b soll IC2 die Steuerspannung so einstellen, dass
der Schleifer von P2 auf GND liegt, d.h. -Ua = -(+Ua).
Wie das genau funktionieren soll, hat sich mir nie so recht
erschlossen. Spielt IC1b nur noch Leistungsverstärker?
Wozu dann R1b? Letzten Endes funktioniert es ja nun
auch nicht.
Die Bauteilwerte sind:
R1a, R1b = 120
R2a, R2b = 100k (nachträglich || 3,9k)
R3 = 1k
P1 = 2,5k Poti || (4,7k + 1k Trimmer)
P2 = 1k Trimmer (nachträglich verkleinert?)
C1a, C1b,
C2a, C2b = 10uF/Ta
C3 = 10n
C4 = 1n
D1, D2 = 1N4001
IC1a = LM317K
IC1b = LM337K
IC2 = 356
T1 = BC141/16
+Uv, -Uv aus 2x18V-Trafo
+5V aus 7805
off abgeleitet aus Stromfühlern
Weiss jemand, wie man das Ding retten kann, oder ist
die Schaltung so verkorkst, dass ich es besser gleich
entsorge?
Auf Hilfe hoffend,
Rainer
Suche Hilfe wegen eines Dual-Labornetzgeraets, das
ich in alten Zeiten gebastelt habe. Der Spannungs-
regelbereich beginnt bei 0V, ab einem einstellbaren
Strom schaltet die Spannung ab (hab ich nicht
eingezeichnet). Die Vorlage stammt aus einer Elektor,
Platinennummer 83121, also wohl Jahrgang 1983; den
Artikel habe ich nicht mehr.
Das Ding habe ich nie richtig zum Laufen gebracht.
Der positive Zweig ist ok, aber der negative macht
Ärger. -Ua wirbelt herum, oder C2b (ein Tantalo)
schlägt gleich durch.
Das ist der relevante Schaltungsteil:
IC1a
_________
+Uv | | +Ua
O-------------o--|In Out|--o------------------o----O
| 2| adj |3 | |
| '---------' | |
off | 1| ___ | |
O----o---o----|------ o-|___|-o |
| | | | R1a | |
,-, | | | | |
| |<-' +| | |+ ,-,
| |P1 ### === ### | |
'-' --- |C3 --- | |R2a
| |C1a | |C2a '-'
| | | | |
O----|--o-----o-------o-------o-------------o----|----O
GND | | | | | | GND
| V |+ |+ +5V | |
| - ### ### O | |
| |D1 --- --- | | |
| V |C1b |C2b 7|/|3 | |
| - | | IC2/+|--' ,-,
| |D2 | ,-------|---o---< | | |
'- o | | | | 6 \-|--o-->| |P2
| | | | === 4|\|2 | '-'
,-, | | | |C4 | | |
| | | | ___ | '----|----' ,-,
| |R3 | o-|___|-o | | |
'-' | | R1b | | | |R2b
| | ___1|____ | | '-'
| | 3| adj |2 | | |
O-------o-----o--|In Out|--o--------o---------o----O
-Uv | | -Ua
'---------'
IC1b
Kurz zur Funktion:
IC1a ist fast in Standardschaltung, P1/R1a legen +Ua fest.
P1 liegt zwei PN-Übergänge unter 0V, damit der Ausgang bis
0V herunter gehen kann. Was C3 soll, weiss ich nicht, zur
Brummunterdrückung ist er jedenfalls zu klein. An off liegt
der (abgeklemmte) Ausgang des Stromfühlers.
An IC1b soll IC2 die Steuerspannung so einstellen, dass
der Schleifer von P2 auf GND liegt, d.h. -Ua = -(+Ua).
Wie das genau funktionieren soll, hat sich mir nie so recht
erschlossen. Spielt IC1b nur noch Leistungsverstärker?
Wozu dann R1b? Letzten Endes funktioniert es ja nun
auch nicht.
Die Bauteilwerte sind:
R1a, R1b = 120
R2a, R2b = 100k (nachträglich || 3,9k)
R3 = 1k
P1 = 2,5k Poti || (4,7k + 1k Trimmer)
P2 = 1k Trimmer (nachträglich verkleinert?)
C1a, C1b,
C2a, C2b = 10uF/Ta
C3 = 10n
C4 = 1n
D1, D2 = 1N4001
IC1a = LM317K
IC1b = LM337K
IC2 = 356
T1 = BC141/16
+Uv, -Uv aus 2x18V-Trafo
+5V aus 7805
off abgeleitet aus Stromfühlern
Weiss jemand, wie man das Ding retten kann, oder ist
die Schaltung so verkorkst, dass ich es besser gleich
entsorge?
Auf Hilfe hoffend,
Rainer