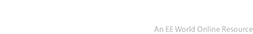W
Wolfgang Draxinger
Guest
Ok, wird etwas lang, aber es wird verständlicher, wenn man weiß
wofür ich das brauche:
Im Moment bin ich dabei, im Praktikumsbereich der LMU Physik
einige computergesteuerte Versuche rundumzuerneuern, d.h. neue
HW und Software - ist noch für XT-Bus, DOS und EGA das alte
Zeug; zuverlässig, aber schön langsam gehen die Ersatzteile aus,
wenn dann doch mal ein Interface stirbt. Nachdem nun der erste
Versuch "Mechanische Schwingungen" komplett umgestellt ist hab
ich einfach mal ausprobiert, wie es ist, das Teil per Internet
fernzusteuern. Das kann das Praktikum nicht ersetzen, aber es
ist unglaublich interessant damit rumzuspielen,
Einschwingvorgänge zu studieren etc.
Irgendwie hat mich jetzt der Bastelwahn gepackt (kennt man ja)
und ich habe heute (es ist Freitag) einfach mal alle Versuche
die wir da haben (auch die nicht computerisierten) abgeklappert
um zu sehen, womit man sich noch stundenlang spielen kann und
das man rein theoretisch auch fernsteuern könnte. Und da ist mir
der Versuch "Stöße" eingefallen: Auf einer Plattform liegt eine
Stahlkugel. Daneben ist eine schräge Bahn auf der eine 2. Kugel
herabrollen kann und am Ende der ersten Bahn die 1. Kugel
zentral, aber mit variablem Stoßparameter stößt. Danach befinden
sich beide Kugeln im freien Fall und schlagen kurz darauf fast
zeitgleich auf dem Boden auf. Zur Aufzeichnung liegt auf dem
Boden Kohlepapier und darüber Transparentpapier. So und da liegt
das Problem für die fernsteuerbare Version: Wie zeichnet man das
auf. Als erstes dachte ich daran ein Raster aus zueinender
senkrechten Drähten im Multiplex anzusteuern. Schlägt die Kugel
am Boden auf berühren sich 2 Drähte. Problem: Der Kontakt ist
nicht mal für eine Mikrosekunde (!) geschlossen. Ich will nicht
die arme Socke sein, die sich mit der EMI einer derart schnellen
Multiplexschaltung rumschlagen muss. Eine andere Idee wäre
gewesen, die Platte auf 4 Piezos zu lagern und über den
Kraftstoß auf die Einzelnsensoren den Ort zu berechnen. Problem:
Die Kugeln kommen fast zeitgleich auf.
Schliesslich bin ich auf folgende Idee gekommen:
Konstantandraht ist in parallelen Linien mit gleichem Abstand und
alternierender Laufrichtung verlegt, also schematisch so:
----------------------------\
|
/---------------------------/
|
\---------------------------\
|
/---------------------------/
|
\----------------------------
Das eine Ende kommt an +5V, das andere an 0V, also ein
klassischer Spannungsteiler. Senkrecht dazu verlaufen vergoldete
(um Korrosion zu vermeiden) Drähte aus Federstahl (immerhin
knallt da eine Kugel mit ordentlich "Wumms" drauf), die
miteinander verbunden sind. Dazwischen ist ein schmaler
Luftspalt und darüber eine Matte aus Silikon o.ä.
Dort wo die Kugel auftrifft wird kurzzeitig die Verbindung
hergestellt und das Abgriff (das Federstahlnetz) auf die
Spannung des Berührpunktes gezogen, aber halt nur sehr kurz.
Misst man die Spannung mit hinreichender Auflösung kann man den
Ort des Aufschlagpunkts bestimmen. Die Frage ist: Wie misst man
das.
Rein theoretisch könnte man einen Kondensator auf daran
anschliessen, dieser wäre aber idealerweise infinitesimal klein,
damit die Ladezeit praktisch 0 wäre. Zum Auslesen käme dann eine
ideale Spannungsmessung zum Einsatz. Sowas gibt es nicht klar.
Was aber gehen müsste, wäre ein unidirektionaler, schneller
Spannungsfolger der bis zum Scheitelpunkt mitläuft, dann aber
auf der Spitzenspannung bleibt. Idealerweise würde er nur auf
den ersten Anstieg reagieren und müsste anschliessend scharf
gestellt werden, so dass weitere Spitzen (die Kugel hüpft
meistens 2, 3 mal auf der Bodenplatte) nicht mehr erfasst
werden.
Und was ist mit der 2. Kugel. Nun, die Bodenplatte wird in 8
Streifen aufgeteilt, die so angeordnet sind, dass die beiden
Kugeln niemals im selben Streifen aufschlagen können
(Impulserhaltung hilft mit). Bei der Kraftstoßmessung wäre das
nicht gegangen, da die Bodenplatte homogen sein soll. Es ist
aber kein Problem, Leiterbahnen entsprechend zu verlegen.
Nach dem Stoß werden von den 8 Streifen die Spannungen am
Spannungsfolger mit einem A/D Ausgelesen und in die Position
umgerechnet.
Jetzt die Frage: Kennt jemand geeignete Spannungsfolger, entweder
als fertigen Baustein oder als diskrete Schaltung aus OP-V und
anderen schönen Sachen?
Wolfgang Draxinger
--
wofür ich das brauche:
Im Moment bin ich dabei, im Praktikumsbereich der LMU Physik
einige computergesteuerte Versuche rundumzuerneuern, d.h. neue
HW und Software - ist noch für XT-Bus, DOS und EGA das alte
Zeug; zuverlässig, aber schön langsam gehen die Ersatzteile aus,
wenn dann doch mal ein Interface stirbt. Nachdem nun der erste
Versuch "Mechanische Schwingungen" komplett umgestellt ist hab
ich einfach mal ausprobiert, wie es ist, das Teil per Internet
fernzusteuern. Das kann das Praktikum nicht ersetzen, aber es
ist unglaublich interessant damit rumzuspielen,
Einschwingvorgänge zu studieren etc.
Irgendwie hat mich jetzt der Bastelwahn gepackt (kennt man ja)
und ich habe heute (es ist Freitag) einfach mal alle Versuche
die wir da haben (auch die nicht computerisierten) abgeklappert
um zu sehen, womit man sich noch stundenlang spielen kann und
das man rein theoretisch auch fernsteuern könnte. Und da ist mir
der Versuch "Stöße" eingefallen: Auf einer Plattform liegt eine
Stahlkugel. Daneben ist eine schräge Bahn auf der eine 2. Kugel
herabrollen kann und am Ende der ersten Bahn die 1. Kugel
zentral, aber mit variablem Stoßparameter stößt. Danach befinden
sich beide Kugeln im freien Fall und schlagen kurz darauf fast
zeitgleich auf dem Boden auf. Zur Aufzeichnung liegt auf dem
Boden Kohlepapier und darüber Transparentpapier. So und da liegt
das Problem für die fernsteuerbare Version: Wie zeichnet man das
auf. Als erstes dachte ich daran ein Raster aus zueinender
senkrechten Drähten im Multiplex anzusteuern. Schlägt die Kugel
am Boden auf berühren sich 2 Drähte. Problem: Der Kontakt ist
nicht mal für eine Mikrosekunde (!) geschlossen. Ich will nicht
die arme Socke sein, die sich mit der EMI einer derart schnellen
Multiplexschaltung rumschlagen muss. Eine andere Idee wäre
gewesen, die Platte auf 4 Piezos zu lagern und über den
Kraftstoß auf die Einzelnsensoren den Ort zu berechnen. Problem:
Die Kugeln kommen fast zeitgleich auf.
Schliesslich bin ich auf folgende Idee gekommen:
Konstantandraht ist in parallelen Linien mit gleichem Abstand und
alternierender Laufrichtung verlegt, also schematisch so:
----------------------------\
|
/---------------------------/
|
\---------------------------\
|
/---------------------------/
|
\----------------------------
Das eine Ende kommt an +5V, das andere an 0V, also ein
klassischer Spannungsteiler. Senkrecht dazu verlaufen vergoldete
(um Korrosion zu vermeiden) Drähte aus Federstahl (immerhin
knallt da eine Kugel mit ordentlich "Wumms" drauf), die
miteinander verbunden sind. Dazwischen ist ein schmaler
Luftspalt und darüber eine Matte aus Silikon o.ä.
Dort wo die Kugel auftrifft wird kurzzeitig die Verbindung
hergestellt und das Abgriff (das Federstahlnetz) auf die
Spannung des Berührpunktes gezogen, aber halt nur sehr kurz.
Misst man die Spannung mit hinreichender Auflösung kann man den
Ort des Aufschlagpunkts bestimmen. Die Frage ist: Wie misst man
das.
Rein theoretisch könnte man einen Kondensator auf daran
anschliessen, dieser wäre aber idealerweise infinitesimal klein,
damit die Ladezeit praktisch 0 wäre. Zum Auslesen käme dann eine
ideale Spannungsmessung zum Einsatz. Sowas gibt es nicht klar.
Was aber gehen müsste, wäre ein unidirektionaler, schneller
Spannungsfolger der bis zum Scheitelpunkt mitläuft, dann aber
auf der Spitzenspannung bleibt. Idealerweise würde er nur auf
den ersten Anstieg reagieren und müsste anschliessend scharf
gestellt werden, so dass weitere Spitzen (die Kugel hüpft
meistens 2, 3 mal auf der Bodenplatte) nicht mehr erfasst
werden.
Und was ist mit der 2. Kugel. Nun, die Bodenplatte wird in 8
Streifen aufgeteilt, die so angeordnet sind, dass die beiden
Kugeln niemals im selben Streifen aufschlagen können
(Impulserhaltung hilft mit). Bei der Kraftstoßmessung wäre das
nicht gegangen, da die Bodenplatte homogen sein soll. Es ist
aber kein Problem, Leiterbahnen entsprechend zu verlegen.
Nach dem Stoß werden von den 8 Streifen die Spannungen am
Spannungsfolger mit einem A/D Ausgelesen und in die Position
umgerechnet.
Jetzt die Frage: Kennt jemand geeignete Spannungsfolger, entweder
als fertigen Baustein oder als diskrete Schaltung aus OP-V und
anderen schönen Sachen?
Wolfgang Draxinger
--