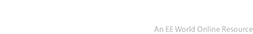M
Marcel Mueller
Guest
Hallo,
wenn man normale Transistoren parallel schaltet braucht man getrennte
Emitterwiderstände, sonst geht's nicht. Kennt man, so steht's an allen
Ecken und Enden.
Jetzt habe ich gerade mal einen Test gemacht und zwei paar BD243/BD244
als Power-OP-Endstufe zusammengeschaltet, also direkt parallel, keine
getrennten Emitterwiderstände. 8Vss Sinus am Ausgang. Dann an ein altes
PC-Netzteil dran (12V) und asymmetrisch mit 2,2 Ohm mal nach Masse, mal
nach +12V belastet. Die Transistorpärchen hatte ich ungekühlt zwischen
den Fingern. Das wird erwartungsgemäß nach wenigen Sekunden recht
"kuschelig". Aber was nicht passiert ist, keiner von beiden war spürbar
wärmer als sein Kumpel. Heißt, der Strom hat sich trotzdem ungefähr
gleich verteilt. Jedenfalls in einem Fenster von 20%. Alles andere hätte
man an der Zeit bis zum Loslassen mühelos unterscheiden können.
Geht's jetzt auf einmal doch?
Marcel
wenn man normale Transistoren parallel schaltet braucht man getrennte
Emitterwiderstände, sonst geht's nicht. Kennt man, so steht's an allen
Ecken und Enden.
Jetzt habe ich gerade mal einen Test gemacht und zwei paar BD243/BD244
als Power-OP-Endstufe zusammengeschaltet, also direkt parallel, keine
getrennten Emitterwiderstände. 8Vss Sinus am Ausgang. Dann an ein altes
PC-Netzteil dran (12V) und asymmetrisch mit 2,2 Ohm mal nach Masse, mal
nach +12V belastet. Die Transistorpärchen hatte ich ungekühlt zwischen
den Fingern. Das wird erwartungsgemäß nach wenigen Sekunden recht
"kuschelig". Aber was nicht passiert ist, keiner von beiden war spürbar
wärmer als sein Kumpel. Heißt, der Strom hat sich trotzdem ungefähr
gleich verteilt. Jedenfalls in einem Fenster von 20%. Alles andere hätte
man an der Zeit bis zum Loslassen mühelos unterscheiden können.
Geht's jetzt auf einmal doch?
Marcel