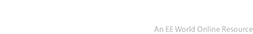H
Hartmut Kraus
Guest
Hallo,
welche Funktion haben in dieser Schaltung R8 und R9?
http://www.parttimeprojects.com/audio/diy/Images/LM4780%20Parallel/lm4780%20parallel%20schematic.PNG
Ist mir echt ein Rätsel. 0,1 Ohm - da dürfte doch der Widerstand von
Leiterzügen -> Klemmverbinder -> etwas längerem Lautsprecherkabel schon
darüber liegen. Aber irgendeinen Sinn müssen sie schon haben, sonst
würden nicht so viele die einbauen. Aber welchen - wer kann mir das
erklären?
welche Funktion haben in dieser Schaltung R8 und R9?
http://www.parttimeprojects.com/audio/diy/Images/LM4780%20Parallel/lm4780%20parallel%20schematic.PNG
Ist mir echt ein Rätsel. 0,1 Ohm - da dürfte doch der Widerstand von
Leiterzügen -> Klemmverbinder -> etwas längerem Lautsprecherkabel schon
darüber liegen. Aber irgendeinen Sinn müssen sie schon haben, sonst
würden nicht so viele die einbauen. Aber welchen - wer kann mir das
erklären?